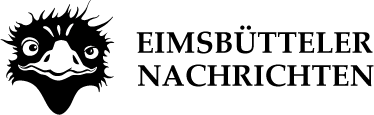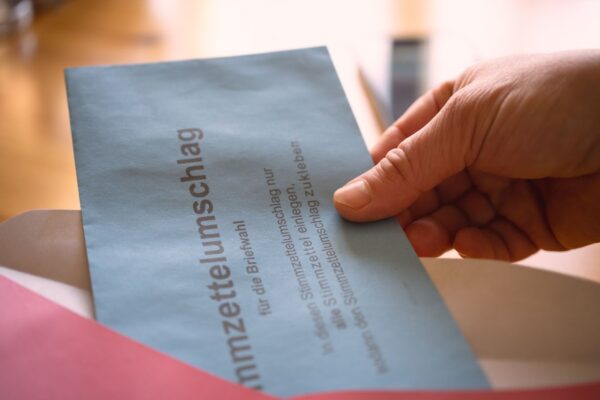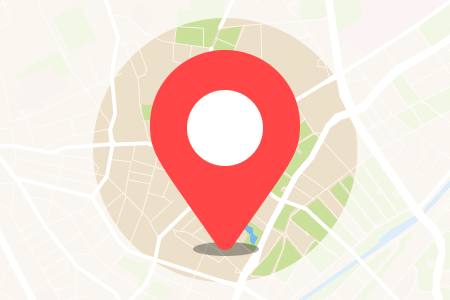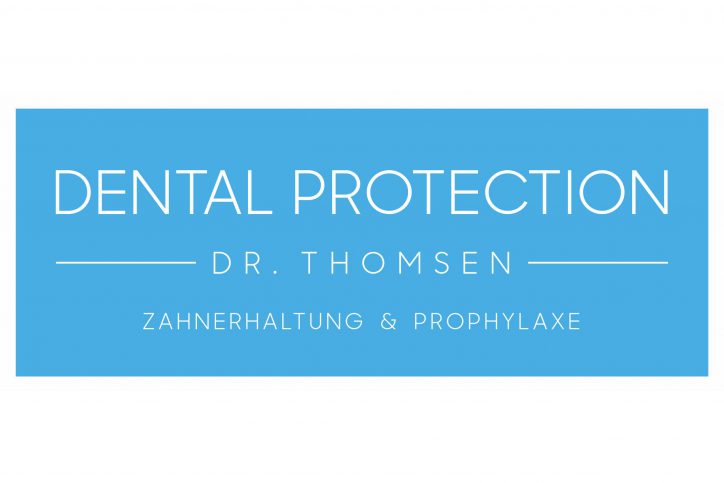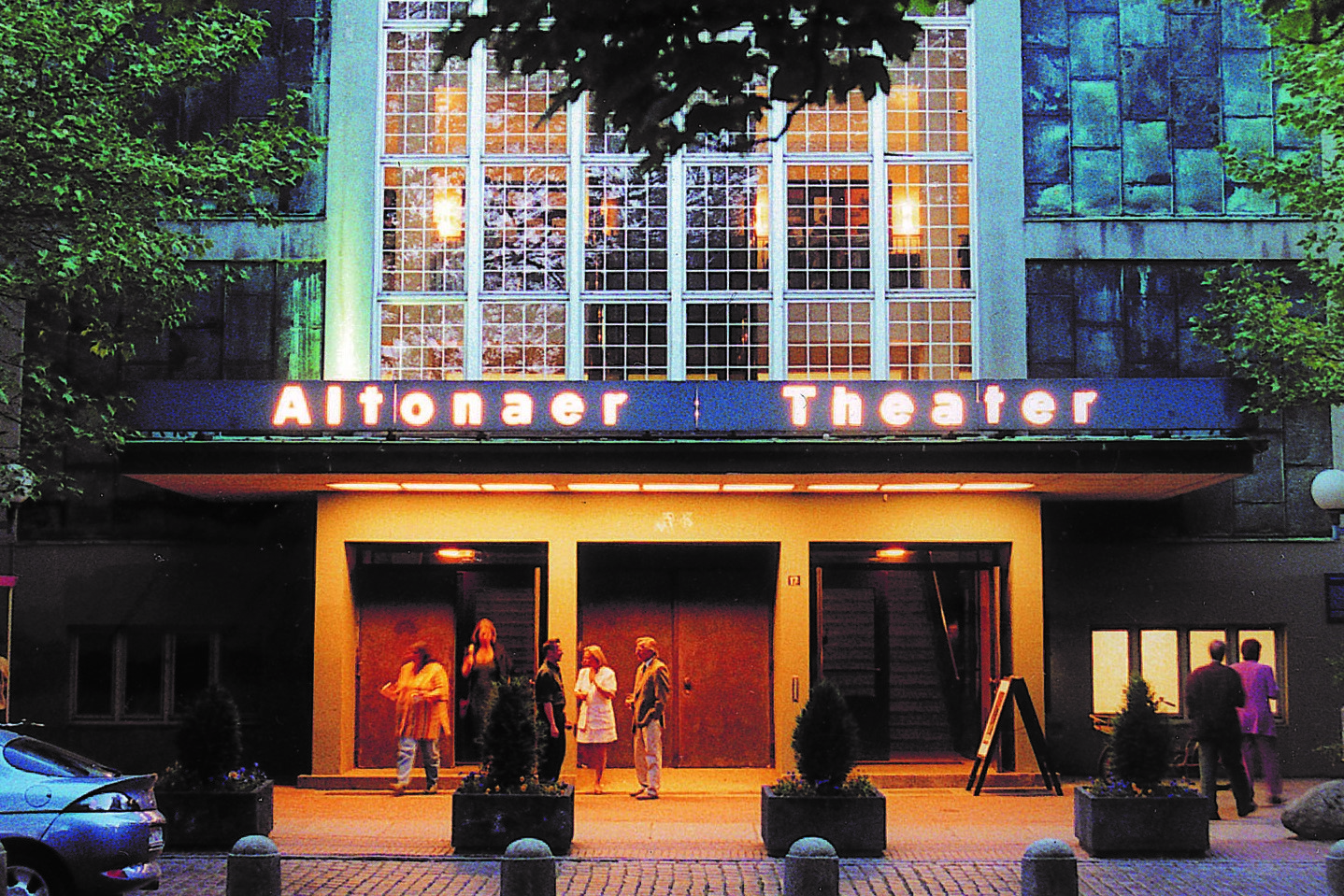Über die Liebe im Nebel
Peter und Anna Lange haben sich im Studium kennengelernt, seit mehr als 43 Jahren sind sie zusammen. Jetzt droht Anna all das zu vergessen. Kann Liebe das aushalten?
Von Julia HaasVon draußen durch das Fenster ist ein Paar zu sehen, das sich nah sein will. Sanft streichelt Peter Lange seiner Frau über den Rücken, sie blickt zu ihm. Er ist der Mann mit den grauen, kurzen Haaren und der dunkelblauen Latzhose, sie, Anna, die Frau mit dem weißen Bob und dem bunten Ringelshirt. Nebeneinander stehen sie am Rande einer großen Tafel, Tannenbäumchen und bunte Weihnachtskugeln schmücken die Tische. Menschen sitzen darum und unterhalten sich. Die Kälte draußen scheint weit weg.
Als er ihre Hand nimmt, winden sich ihre Finger aus der Berührung. Sie läuft zur Tafel und setzt sich. Später wird sie fragen: „Was machen alle hier?”
Wohn-Pflegegemeinschaft für Menschen mit Demenz
In einer Erdgeschosswohnung nahe des UKE findet an diesem Nachmittag im Dezember eine Weihnachtsfeier statt. Töchter, Söhne und Enkelkinder sind gekommen, um mit ihren Müttern oder Omas Lebkuchen zu essen und Punsch zu trinken. Peter Lange ist gekommen, um bei seiner Frau zu sein.
Sie sind seit über 43 Jahren zusammen, vor knapp einem Jahr haben sie sich räumlich getrennt. Peter und die gemeinsamen Söhne haben Anna in einer Wohn-Pflegegemeinschaft für Menschen mit Demenz untergebracht. Mit 65 Jahren ist sie die jüngste Bewohnerin.
Sie können nicht mehr alleine leben
In Deutschland leben etwa 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. So gibt es das Statistische Bundesamt an. Neben Gedächtnisverlusten kann es zu Einschränkungen der Sprache, der Aufmerksamkeit oder der Orientierung kommen. Manchmal wird von einem „Nebel” im Kopf der Betroffenen gesprochen.
Alzheimer-Betroffene verlieren die Fähigkeit, gewohnte Handlungen zu bewältigen: Sie können irgendwann nicht mehr kochen, nicht einkaufen, sie können nicht mehr ohne Hilfe auf die Toilette gehen, die Zähne putzen, mit Kontaktlinsen umgehen, Schuhe anziehen. Sie verlieren die Fähigkeit zu lesen, sich zu äußern, zu entscheiden, zu planen. Kurz, sie können nicht mehr allein leben.
Demenz erschwert eine Beziehung
Seit Peters Frau an Alzheimer-Demenz erkrankt ist, gibt es viele Gefühle, die seine Beziehung zu ihr prägen. Mal ist es Schuld, sie alleine zu lassen, mal ist es Sehnsucht nach der Person, die sie einst war. Oft ist es Verzweiflung.
Die beiden heißen anders. Doch Peter möchte nicht erkannt werden, und er möchte seine Frau nicht outen. Die Demenzerkrankung erschwert die Beziehung, sagt er. Sie reißt alles mit sich.
Peter legt ein Stück Christstollen auf den Pappteller seiner Frau. „Das kannst du mit den Fingern essen”, sagt er zu ihr, während er einen Stuhl zu ihr schiebt und sich neben sie setzt. Dann nimmt er den Pappbecher, den sie eben noch in der Hand hielt, und trinkt einen Schluck.
„Ist ja wirklich mit Atomstrom”, sagt er zu seiner Frau und grinst.
„Atomstrom?”, fragt sie ernst.
„Alkohol”, sagt er und lacht. „Im Glühwein”, schiebt er hinterher.
„Ah, ich habe nichts davon gegessen”, antwortet sie und dreht sich weg.
Das Verlieben
Die Liebesgeschichte von Peter und Anna begann auf dem Campus der Universität Hamburg. In einem Kellerraum, in dem die Zweitsemester der Kunstgeschichte den Erstsemestern die Uni zeigten. Anna war damals 20, im zweiten Semester; Peter 19 und neu an der Uni. Sie schenkte am anderen Ende des Raums Kaffee aus. „Da haben sich unsere Blicke zum ersten Mal getroffen.” Das ist 45 Jahre her. Anna war die erste Frau, die Peter nach Hause brachte.
Sie zogen zusammen, heirateten Jahre später und bekamen zwei Söhne. Natürlich gab es Krisen, erzählt Peter. „Aber ich hatte nie den Wunsch, ohne sie zu leben.”
Während sich Peter um die Kinder kümmerte und freiberuflich arbeitete, war sie die Vollverdienerin. Einmal war er mit den Söhnen beim Friseur in der Hoheluftchaussee. Der eine wollte aus dem Nichts rote Haare. „Ich war zu meiner eigenen Überraschung unsicher, bin raus und habe Anna angerufen”, erinnert sich Peter heute. „Warum nicht?”, soll sie gesagt haben. Warum nicht?
Später, als die Söhne größer waren, pflegte das Paar Annas und Peters Eltern. Gemeinsam. Die wollten nicht ins Altersheim, also waren Peter und Anna dran. Weil ihre Familie zu seiner geworden war, und umgekehrt.
Die Entfernung
Wann es anfing, dass sich seine Frau veränderte, weiß Peter nicht exakt. Vielleicht vor acht Jahren, vielleicht ist es länger her. Was er genau erinnert: Sie waren sich immer nah, und irgendwann war da etwas zwischen ihnen. In Gesprächen war sie eine andere geworden, war abwesend. Sie vergaß Verabredungen, mied die Nähe, war abweisend.
Früher, an den Wochenenden war es seine Frau gewesen, die kochte. Er war dann mit den Söhnen beim Sport. Wenn sie zurückkamen, stand das Essen auf dem Tisch. „Ihr war das wichtig”, sagt Peter. Weil sie unter der Woche arbeitete, wollte sie am Wochenende die Mutter sein, die sie sonst nicht sein konnte. Irgendwann stand das Essen nicht mehr auf dem Tisch.
Stattdessen fand Peter seine Frau in der Küche. Mal weinte sie, mal war sie wütend. Die Töpfe auf den Herd zu stellen, die Zutaten in der richtigen Reihenfolge hinzuzugeben – es ging nicht mehr. Er schob sie dann aus der Küche. So erzählt er es heute.
Damals sei er irritiert gewesen, auch genervt. Da war Mitleid, sagt er, und Abwehr. Eine Last in der Beziehung, wie er sie nicht kannte.
Eine Demenzerkrankung geht häufig mit depressiven Symptomen einher. Es können Jahre vergehen, bis die Diagnose feststeht. In Annas Fall war es so. Erst im Sommer 2021, nach mehreren Untersuchungen in unterschiedlichen Abteilungen des UKE, bekam all das, was sich seit Jahren abzeichnete, einen Namen: Alzheimer-Demenz.
Anna war damals 61 Jahre alt. „Kein Alter, in dem man über Demenz nachdenkt”, sagt ihr Mann.
Offiziell sind rund fünf Prozent der Demenzerkrankten jünger als 65. Wahrscheinlich sind es mehr, jedoch werden die Symptome in diesem Alter oft nicht als Demenz erkannt.
Die Gewissheit
Mit der Diagnose kam die Gewissheit, aber keine Erleichterung. Demenz ist eine degenerative Krankheit, die nicht aufgehalten und nicht geheilt werden kann. „Du weißt, es wird immer beschissener,” sagt Peter, „niemand kann etwas dagegen tun.” Er wusste jetzt, dass die Entfernung seiner Frau nichts mit ihm oder ihrer Beziehung zu tun hatte, gleichzeitig aber auch, dass die Liebe von früher nicht zurückkehren würde.
„Als Ehemann hast du zwei Möglichkeiten: dich irgendwann vom Acker zu machen oder dich über alle Maßen zu kümmern.”
Als die Diagnose bereits einige Monate in der Krankenakte stand, entschieden Peter und Anna, in die Berge zu fahren. Seit ihren Zwanzigern fuhren sie Ski. „Ihr ging es damals gut”, sagt Peter. Mit den Gedächtnisproblemen wäre er klargekommen.
Doch als Anna auf den Skiern stand, beflügelten sie sie nicht wie früher; sie brachten sie zu Fall. Immer wieder stürzte sie oder wollte ohne die Stöcke losfahren. Was früher normal war, nach einem Sturz aufzustehen, weiterzumachen, war ihr fremd geworden. Sie hatte Angst. Also kam Peter, half ihr, brachte sie zur nächsten Station und fuhr mit ihr ins Tal.
Unten, im Hotel, nässte sie sich im Bett ein. In dieser Nacht machten er und sein jüngerer Sohn, der im Urlaub dabei war, kein Auge zu. Vielleicht war es die Nacht, in der Peter vom Ehemann zum pflegenden Ehemann wurde – und der Sohn zu einem, der seiner Mutter nachtrauerte.
Die Überforderung
Mit der Demenz veränderte sich die Ehe. Peter pflegte nun seine Frau. Er zog sie morgens an und abends wieder aus. Er wusch sie, ging mit ihr zur Toilette. Die Intimität zweier Liebenden war der einer Gepflegten und eines Pflegenden gewichen. Scham, wenn sie sich einnässte, Streit, wenn das Bein nicht in die Hose wollte, Genervtheit, wenn sie wieder das Portemonnaie verlegte. Die Liebe war einem Ertragen gewichen, einem Verzweifeln und Aushalten.
Oft geht die häusliche Pflege mit Überforderung und einer Rollenverschiebung einher, sagt Malte Kock. Er ist beim DRK Soziale Dienste Eimsbüttel für den Bereich Demenz zuständig, betreut Projekte wie die Wohn-Pflegegemeinschaft von Anna. Wenn der Ehepartner zur Pflegekraft werde, löse das extreme Gefühle aus. Ärger, Wut und auch Ekel, sagt er.
Einmal sind Peter und Anna mit Freunden ins Restaurant gegangen. Wie früher, und doch ganz anders. Statt mit der Gabel zu essen, patschte sie mit den Fingern in der Sauce. Wenn er ihr das Essen auf die Gabel piekste, griff sie mit der Hand zu. Dann ging sie auf die Toilette, um die Hände zu waschen. Im Bad machte sie sich in die Hose.
„Wie geht man damit um, ohne sauer zu werden?”, fragt Peter ohne eine Antwort zu erwarten. „Man darf nicht sauer sein”, schiebt er hinterher. Vor allem er nicht als Ehemann. Damals fragte er sich, wie lange er das aushalten könne. Er wandte sich damit an den Neuropsychotherapeuten, bei dem Anna in Behandlung war. Und er suchte Hilfe bei der Alzheimer Gesellschaft Hamburg, bei der er noch heute eine Selbsthilfegruppe besucht.
Dann wurde er selbst krank.
Alle Jahre wieder, Schneeglöckchen, Oh Tannenbaum. In der Wohn-Pflegegemeinschaft werden Liedblätter verteilt. „Die kann ich doch auswendig”, sagt Anna und lacht. Dann fällt ihr das Liedblatt aus der Hand, ohne dass sie es bemerkt. Peter legt seins vor sie.
Etwas später gibt es Geschenke. Eine Schneekugel. Anna dreht sie in der Hand. „Was ist das?” Sie lacht. Dann vergisst sie die Kugel. Peter hatte seine Hand schon darauf vorbereitet, dass ihre bald loslassen würde, und fängt sie auf.
Die Trennung
Vor einem Jahr kam Peter ins Krankenhaus. Krebs. Die Erkrankung war kurz zuvor entdeckt worden, als er mit einer Sepsis in die Klinik eingeliefert wurde. Dass sein Körper damit gegen die Belastung der vergangenen Monate rebelliert hat, glaubt er eigentlich nicht.
Gesund werden und seine Frau pflegen, das ging nicht. Während Peter im Krankenhaus lag, organisierten seine Söhne ein Pflegeheim. „Nach 43 Jahren musste ich das Zusammenleben mit meiner Frau beenden”, sagt er. Eine Trennung, die er nie wollte, irgendwann aber nicht mehr verhindern konnte.
Nach einer kurzen Zeit im Pflegeheim zog Anna in die Wohn-
Pflegegemeinschaft. Eine WG für Menschen mit Demenz. Durch die Angehörigen finanziert und organisiert, vom Pflegepersonal der Sozialen Dienste Eimsbüttel betreut.
Die WG besteht aus zehn Zimmern mit eigenem Bad, einer offenen Küche mit Aufenthaltsbereich. Dort stehen Sofas, ein großer Tisch, an der Wand hängen Fotos der Bewohner, ein Plakat, das an die Geburtstage erinnert. Es gibt genug Platz, sodass zur Weihnachtsfeier alle Bewohner, ihre Angehörigen und Pflegekräfte an einer Tafel sitzen können. Es wirkt warm; nicht nur, weil es draußen kalt ist.
Malte Kock versteht die Wohn-Pflegegemeinschaft auch als eine Ersatzfamilie. Für ihn stehe die Betreuung im Fokus, sowohl mit den Bewohnerinnen als auch den Angehörigen. Die Pflege gehört dazu.
Die Schuld
Es ging nicht anders, sagt Peter in mehreren Gesprächen über die Trennung. Und trotzdem ist da die Schuld, die nur dann schwächer wird, wenn er die WG betritt. Das Schuldgefühl sei so massiv, dass er sich Tag für Tag mehr aufgebe.
Außer seiner Arbeit sei da nur noch die Pflege für seine Frau. Auch wenn er den pflegerischen Part, sie zu waschen, mit ihr auf die Toilette zu gehen, abgegeben hat, versucht er, sie täglich zu besuchen.
Was von ihm geblieben ist? Der pflegende Ehemann. Viel mehr nicht. So erzählt er es.
Die Trauer
Nach der Trennung von seiner Frau ist Peter in eine kleinere Wohnung, näher bei der WG gezogen – mit Einzelbett. Das Ehebett, das er vor Jahrzehnten für Anna und sich gebaut hatte, hat er auseinander gesägt, das Holz an Freunde gegeben, die einen Kamin haben.
„Ich glaube, meine Frau denkt, sie könnte jederzeit bei mir schlafen.” Dass das nicht geht, könnte er ihr erklären. Nur würde sie es nicht verstehen. Also überlegt er sich Ausreden. Auch das gehört jetzt zu ihrer Beziehung: Die Tatsachen so zu verhüllen, dass sie Anna nicht überfordern. Um sie herum reden. Ausweichen. Wie man es auch nennen mag, es ist etwas, das Peter in einer Beziehung nie wollte.
Darf man Menschen mit Demenz belügen? In der Pflege und im Angehörigenkreis sehen sich viele mit dieser Frage konfrontiert, weiß Malte Kock. Er sagt aber auch: „Das ist Quatsch.” Demenzkranke befänden sich in einer anderen Realitätswirklichkeit – dort müssten sie abgeholt werden. Angehörige müssten lernen, dass ein Teil der geliebten Person quasi in einer parallelen Welt lebe.
Irgendwann hat Peter vom Begriff der „Weißen Trauer” gehört. Die Trauer, um einen Menschen, der nicht verstorben, aber dennoch nicht mehr wirklich da ist. „Meine Frau, wie ich sie geliebt habe, ist verschwunden”, sagt er.
Die Erkrankung hat auch Peters Leben mit sich gerissen. Abends, erzählt er, sitze er allein in der neuen Wohnung, habe keine Lust zu kochen oder abzuwaschen. Vor einiger Zeit war er mit seinem Bruder bei einem Chorauftritt von dessen Tochter. Früher wäre er mit Anna zu solchen Veranstaltungen gegangen. Wenn ihre Jungs vorne standen, saßen sie nebeneinander im Publikum. Jetzt, als er da ohne sie saß, weinte er.
Er ist geblieben, er bleibt
„Was machen hier denn alle?”, fragt Anna, während eine andere Bewohnerin ein Gedicht an der Weihnachtstafel vorliest.
„Weihnachten feiern”, sagt Peter
„Warum?”, will Anna wissen.
„Ist egal. Dein Highlight war heute der Besuch unserer Enkelin, oder?”
„Ja, wenn meine Liebsten zu mir kommen.”
Noch erkennt Anna das Gesicht von Peter oder die ihrer Söhne. Niemand weiß, wie lange das so bleibt. Peter hat entschieden, die Angst davor nicht alles bestimmen zu lassen.
Eine Woche vor der Weihnachtsfeier waren sie gemeinsam bei Ikea in Schnelsen. Ein Geburtstagsgeschenk für ihren Sohn besorgen. Er versucht sie dann an der Hand zu nehmen, auch wenn sie ihm immer wieder entweicht, und ein Stück durch das alte gemeinsame Leben zu führen. Wenn sie auf die Toilette muss, geht er mit ihr in die Kabine, versucht sie zu setzen und wieder aufzurichten. Das sei anstrengend, oft würden sie sich in solchen Momenten streiten.
Das Leben wie früher, die Liebe von früher ist verschwunden und einer neuen Form der Beziehung gewichen. Daran hält er fest. „Die Liebe muss sich neue Strategien überlegen”, sagt er. Die räumliche Trennung helfe ihm inzwischen dabei. Wenn er nicht mehr kann, geht er nach Hause. So bedeutet die Liebe nicht nur Last, sie gibt wieder Freiräume.
Jetzt steht Peter draußen vor dem Fenster, seine Frau singt mit den anderen Weihnachtslieder. Sie ist nicht alleine, das weiß er. Morgen kommt er wieder.
Hilfe bei Demenz
Die Sozialen Dienste Eimsbüttel, eine Tochtergesellschaft des DRK-Kreisverbandes Hamburg-Eimsbüttel , bieten verschiedene Hilfen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an.
Weitere Anlaufstellen finden Betroffene bei der Alzheimer Gesellschaft Hamburg.
lokal. unabhängig. unbestechlich.
Eimsbüttel+

Mit Eimsbüttel+ hast du Zugriff auf alle Plus-Inhalte der Eimsbütteler Nachrichten. Zudem erhältst du exklusive Angebote, Deals und Rabatte von unseren Partnern.